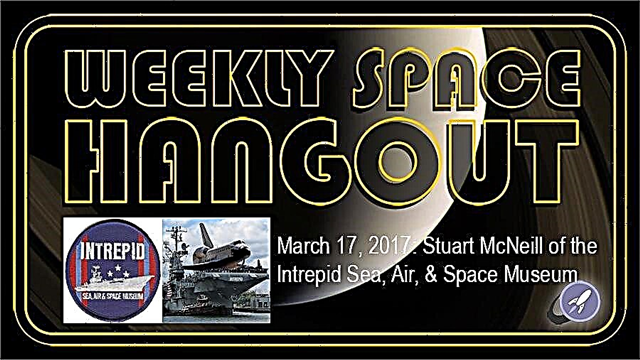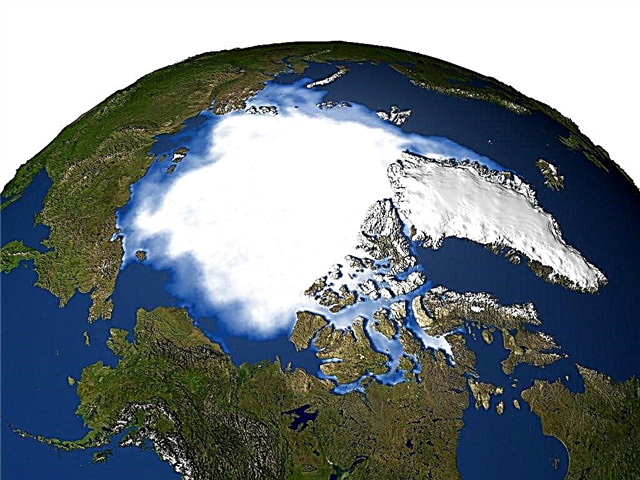Bittersalze, von denen angenommen wird, dass sie auf dem Mars verbreitet sind, könnten dort eine wichtige Wasserquelle sein, sagen Geologen der Indiana University Bloomington und des Los Alamos National Laboratory. In ihrem Bericht in Nature dieser Woche spekulieren die Wissenschaftler auch, dass die Salze eine chemische Aufzeichnung des Wassers auf dem Roten Planeten liefern werden.
"Der Mars Odyssey-Orbiter hat kürzlich gezeigt, dass im oberflächennahen Mars bis zu 10 Prozent Wasser verborgen sein können", sagte David Bish, Haydn Murray-Lehrstuhl für Angewandte Tonmineralogie an der IU und Mitautor des Berichts. „Wir konnten zeigen, dass Magnesiumsulfatsalze unter marsähnlichen Bedingungen viel Wasser enthalten können. Unsere Ergebnisse legen auch nahe, dass die Arten von Sulfaten, die wir auf dem Mars finden, uns viel Einblick in die Geschichte der Wasser- und Mineralbildung geben könnten. “
Die Wissenschaftler erfuhren, dass Magnesiumsulfatsalze äußerst empfindlich auf Änderungen von Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit reagieren. Aus diesem Grund argumentieren die Wissenschaftler, dass die in den Salzen enthaltenen Informationen leicht verloren gehen könnten, wenn Proben zur Untersuchung auf die Erde zurückgebracht würden. Stattdessen sollten künftige Missionen zum Mars die Eigenschaften der Salze vor Ort messen.
Die Existenz von Magnesiumsulfatsalzen auf dem Mars wurde erstmals von den Wikinger-Missionen 1976 vorgeschlagen und seitdem vom Mars Exploration Rover sowie von den Missionen Odyssey und Pathfinder bestätigt. Eine Möglichkeit, die verbleibenden Zweifel daran, dass die Salze tatsächlich vorhanden sind, zu zerstreuen, besteht darin, einen Marsrover mit einem Röntgendiffraktometer auszustatten - einem Instrument, das die Eigenschaften von Kristallen analysiert. Zufälligerweise könnte ein solches Gerät auch zur Untersuchung von Magnesiumsulfatsalzen auf dem Mars verwendet werden. Bish und Mitarbeiter der NASA Ames und Los Alamos entwickeln derzeit ein miniaturisiertes Röntgendiffraktometer mit NASA-Mitteln.
Einige Magnesiumsulfatsalze fangen mehr Wasser ein als andere. Epsomit enthält beispielsweise das meiste Wasser - 51 Gewichtsprozent -, während Hexahydrit und Kieserit weniger Wasser enthalten (47 Gewichtsprozent bzw. 13 Gewichtsprozent). Das Verhältnis von Wasser zu Magnesiumsulfat beeinflusst die chemischen Eigenschaften der verschiedenen Salze.
Während die Temperatur, der Druck und die Luftfeuchtigkeit in einer Versuchskammer variierten, untersuchten die Wissenschaftler, wie sich die verschiedenen Magnesiumsalze im Laufe der Zeit umwandeln.
Wenn Temperatur und Druck in einer Versuchskammer auf marsähnliche Bedingungen gesenkt wurden (minus 64 Grad Fahrenheit und weniger als 1 Prozent des normalen Oberflächendrucks der Erde), wandelten sich Epsomitkristalle zunächst in etwas weniger wässrige Hexahydritkristalle um und wurden dann unorganisiert Sie enthielten immer noch Wasser. Im Gegensatz dazu lässt "Kieserit sein Wasser nicht sehr leicht los, selbst bei sehr niedrigem Druck und hoher Luftfeuchtigkeit oder bei erhöhten Temperaturen", sagte Bish.
Als die Wissenschaftler die Luftfeuchtigkeit in der Versuchskammer erhöhten, stellten sie fest, dass sich Kieserit in Hexahydrit und dann in Epsomit umwandelte, die mehr Wasser enthalten.
Bish und seine Kollegen aus Los Alamos glauben, dass der Anteil und die Verteilung von Hexahydrit, Kieserit und anderen Magnesiumsulfatsalzen auf dem Mars möglicherweise Aufzeichnungen über vergangene Klimaveränderungen und darüber enthält, ob Wasser dort einmal geflossen ist oder nicht. Kieserit kann jedoch möglicherweise nicht durch Benetzungs- und Trocknungszyklen konserviert werden, da es zu Hexahydrit und Epsomit rehydrieren kann, die dann durch Trocknen amorph werden können.
Die Geologen des Los Alamos National Laboratory, David Vaniman, Steve Chipera, Claire Fialips, William Carey und William Feldman, trugen ebenfalls zur Studie bei. Es wurde aus Mitteln des LANL Directed Research and Development Funding und des NASA Mars Fundamental Research Program finanziert.
Originalquelle: Pressemitteilung der Indiana University